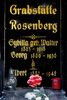Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs zerstörten insbesondere diesen Teil des Friedhofs sehr schwer. Alleine drei direkte Bombentreffer wurden auf dieser verhältnismäßig kleinen Fläche registriert. Was die Bomben verschonten, wurde durch Plünderer geraubt oder zerstört. Im Zuge der Wiedergutmachung verpflichtete sich die Stadt Dortmund nach 1945 den jüdischen Friedhofsteil zu sanieren. Bombentrichter wurden beseitigt, die beiden Reihenfelder eingeebnet, Rasen ausgesät und eine neue Wegeanlage angelegt. Für die Dortmunder jüdischen Glaubens, die Opfer des national-sozialistischen Regimes wurden, wurde ein Denkmal mit Inschrift errichtet. Jüdische Bestattungen wurden auf dem Ostfriedhof ab 1936 eingeschränkt und 1943 eingestellt. Auch nach 1945 fanden hier keine jüdischen Bestattungen mehr statt; für sie wurde ein separates Areal des Hauptfriedhofs Dortmund reserviert.
Auf Feld 14 ranken sich viele Geschichten und Anekdoten um die Namen der hier Bestatteten. Isidor Goldschmidt etwa starb 1919. Der Getreidegroßhändler hatte 1888 die Dortmunder Getreidebörse mit gegründet und Dortmund damit zum Zentrum des regionalen Kornhandels gemacht. Das erste Telefon in Dortmund soll ihm gehört haben. Seine Nichte Bertha heiratete den berühmten Kunsthändler und -sammler Alfred Flechtheim, der heute als bedeutender Förderer avantgardistischer Kunst gilt. In Dortmund sorgte das damals nicht gerade für Bewunderung: Flechtheim legte einen Teil der Mitgift in kubistischer Kunst an, sehr zum Entsetzen seiner Schwiegereltern.
Mahnmal für die jüdischen Opfer des NS-Regimes
▲ Das Mahnmal für die jüdischen Opfer des NS-Regimes auf dem Dortmunder Ostfriedhof ist „Den Toten der jüdischen Gemeinde Dortmund 1933-1945“ gewidmet. Es zeigt einen Davidstern und trägt unter einer hebräischen Inschrift noch die Zeilen: „Im Angesicht Gottes eingedenk ihrer Lieben mussten sie ihr Leben lassen für den Glauben ihrer Väter.“ Die hohe Stele aus hellem Naturstein steht auf einem Sockel, verjüngt sich leicht nach oben und endet in einem waagerechten Abschussstein. Vor ihr ist auf einem kleinen Podest ein breiter Blumenkübel platziert. Das Ensemble erhebt sich auf einer rechteckigen Grundplatte, zu der fünf Stufen hinaufführen. Die Gedenkstätte wird von sechs Steinen eingefriedet, die mit Ketten verbunden sind und als Inschriften die Namen der Konzentrationslager Auschwitz, Mauthausen, Theresienstadt, Buchenwald, Zamosch (Zamoœæ) und Riga tragen, zu den Dortmunder Juden deportiert wurden.
Technik / Material: Stein
Höhe: Steinplatte mit Schriftzug: max. 3,17 m; Schale: 0,6 m; Stufen: 0,16 m;
Breite: Steinplatte: 1,38 m; Stufen: 1m;
Durchmesser: Schale: 1,04 m;
Kunstwerknr.: 44143-006
"DEN TOTEN/ DER/ JÜDISCHEN GEMEINDE/ DORTMUND/ 1933-1945"
hebräischer Schriftzug mittig;
unten: "IM ANGESICHT GOTTES/ EINGEDENK IHRER LIEBEN/ MUSSTEN SIE IHR LEBEN LASSEN/ FÜR DEN GLAUBEN IHRER VÄTER"
je auf einem der sechs Begrenzungssteine:
"AUSCHWITZ", "MAUTHAUSEN", "THERESIENSTADT", "BUCHENWALD", "ZAMOSCH", "RIGA"
Schon ab 1943 hatten die Nationalsozialisten keine jüdischen Bestattungen mehr auf dem Friedhof erlaubt. Während des zweiten Weltkrieges wurde der jüdische Friedhof durch Bombentreffer nahezu völlig zerstört. Heute steht hier ein Mahnmal für die jüdischen Opfer des NS-Regimes. Es wird umarmt von einer Reihe mit Ketten verbundener Steine, die die Namen verschiedener Konzentrationslager tragen.
Auf dem jüdischen Teil des Ostfriedhofs wird bereits seit 1921 niemand mehr bestattet. 1898 angelegt, wurden viele der Grabstätten im Krieg beschädigt und durch Nationalsozialisten geschändet – der Originalzustand konnte später nicht vollständig wiederhergestellt werden. Aber auch hier, auf Feld 14, ranken sich viele Geschichten und Anekdoten um die Namen der hier Bestatteten. Isidor Goldschmidt etwa starb 1919. Der Getreidegroßhändler hatte 1888 die Dortmunder Getreidebörse mit gegründet und Dortmund damit zum Zentrum des regionalen Kornhandels gemacht. Das erste Telefon in Dortmund soll ihm gehört haben. Seine Nichte Bertha heiratete den berühmten Kunsthändler und Kunstsammler Alfred Flechtheim, der heute als bedeutender Förderer avantgardistischer Kunst gilt. In Dortmund sorgte das damals nicht gerade für Bewunderung: Flechtheim legte einen Teil der Mitgift in kubistischer Kunst an, sehr zum Entsetzen seiner Schwiegereltern.
Isidor Schönbach
Schönbach Isidor
Geb. 13.07.1859 Schermbeck (Kreis Rees)
Gest. 26.04.1906
Kaufmann;
Sohn der Eheleute Philipp Schönbach (Lohgerber)
und Rika geb. Steinberg
verheiratet mit Toni geb. Eppstein
Isaak Kahn
1847 - 1911
10.07.1847 Dortmund
19.09.1911 Dortmund
Viehhändler;
Sohn des Handelsmannes Herz Kahn und Jette geb. Baruch;
verheiratet mit Fanny geb. Rosenberg
Bertha Rhee geb. Winter
1844 - 1899
Albert Rhee
1839 - 1903
Die Grabsteine der Eheleute Bertha und Albert Rhée auf dem Ostfriedhof, die inzwischen älter als 120 Jahre sind, befinden sich in einem guten Zustand. Albert Rhée war ein Einzel- und Großhändler, der in seinem Leben mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Das von seinem Sohn Max fortgesetzte Unternehmen konnte schließlich sein 50jähriges Jubiläum begehen.
Auguste Horn, geb. Löwenberg
13.08.1832 - 08.01.1899
Salomon Horn
02.12.1835 - 01.07.1902
Rosa Elias, geb. Benjamin
08.04.1814 - 13.05.1899
Elias (Aron) Adolph 14.09.1837 Geldern 18.07.1903 Dortmund
Kaufmann; Sohn des Kaufmannes Salomon Elias und der Rose geb. Benjamin; verheiratet mit Julie geb. Schwarz;
Vater von Dr. jur. Otto, Elisa Levison,
Toni Oestrich, Grete Frank
Julius Biermann
13.06.1861 - 15.05.1899
Paul Löwenberg und Hermann Löwenberg
Paul Löwenberg
01.10.1879 - 12.06.1916 gefallen
Herm. Löwenberg
26.09.1841 - 26.08.1922
Rechts im Bild: Grabstätte Salomon Goldschmidt. Er entwickelte sich in Dortmund von einem Kolonialwarenhändler zu einem erfolgreichen Immobilienkaufmann. Grundstücks- und Haus(ver)käufe, an denen er beteiligt war, wurden immer wieder in der Tagespresse genannt. Dabei muss davon ausgegangen werden, dass viele Geschäfte gar nicht erwähnt wurden. Das Grab der Eheleute Salomon Goldschmidt auf dem Ostfriedhof ist erhalten, das Grabmal aber nicht mehr vollständig. Es fehlt die einstmals eingesetzt gewesene Inschriftentafel. Heute findet sich der Name Goldschmidt nur an der Grabeinfassung.
Paul Löwenberg
01.10.1879 - 12.06.1916
Herm. Löwenberg
26.09.1841 - 26.08.1922
ohne Inschrift
Grabstätte Rosenberg
Sybilla Rosenberg geb. Walter
1863 - 1918
Georg Rosenberg
1860 - 1936
Albert Rosenberg
1887 - 1942
Tochter des Bäckermeisters Samuel Walter und der Maria Anna geb. Maier; verheiratet mit dem Kaufmann Georg Rosenberg;
Mutter des Kaufmannes und Landsturmmannes Albert geb. 1887
Ehemann Georg Rosenberg geb.1860
Sohn Albert Rosenberg geb.1877
Familiengrab mit dem Ehemann Georg und dem Sohn Albert
Grabstein Cohen
Leeser Cohen 1850 - 1915
Johanna Cohen geb. Rosenfeld 1846 - 1928
Henny Gerson geb. Cohen 1880 - 1929
Cohen Leeser
24.08.1850 Ahlen
10.10.1915 Dortmund
Kaufmann, Adressbuch 1894: Kolonialwaren en gros und Fässer-Handlung, Weißenburgerstr. 1; Adressbuch 1915: Petroleum-Import und Faßhandlung, Kaiserstraße 13; fast 40 Jahre Mitglied der Repräsentanten Versammlung; ferner Mitglied der jüdischen Armenverwaltung sowie der Chevra und Berater und Schriftführer des Israelitischen Frauenvereins; verheiratet mit Johanna geb. Rosenfeld; Vater von Dr. Sally Cohen, Ilse, Julie und Hildegard Ehefrau Johanna Cohen geb. Rosenfeld geb. 20.02.1846, Tochter Henriette verh. Gerson geb. 14.07.1880
gest.18.01.1929
Cohen Johanna Rosenfeld
20.02.1846 Beverungen (Kreis Höxter)
25.06.1928 Dortmund
Tochter Henriette Cohen
verh. Gerson
geb. 14.07.1880
gest. 18.01.1929
Der Kaufmann Leeser Cohen, einer der ersten der sich 1899 mit seinem Unternehmen am neuen Dortmunder Hafen ansiedelte, war ein außerordentlich aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde der Stadt: Fast vier Jahrzehnte gehörte er der Repräsentanten-Versammlung der Synagogen-Gemeinde an, war langjähriges Mitglied der Armen-Unterstützungskommission, Schriftführer des israelitischen Frauenvereins, Mitglied im Vorstand der israelitischen Schule und des Waisenhauses in Dinslaken sowie im Kuratorium für jüdische Krankenpflege in Westfalen.
Ruhestätte Max Levy
Max Levy 23.02.1858 - 13.01.1917
Zur Erinnerung an die in der Verbannung 1942 - 1945 Verstorbenen
Emma Levy 1862 - xxxx
Hedwig Levy 1893 - xxxx
Alice Levy 1902 - xxxx
Levy Max geb. 23.03.1859 (andere Angaben auf dem Grabstein) gest. 13.01.1917
Kaufmann und Agent, Häute- und Fellhandlung, am Städtischen Schlachthof; Bornstraße 20, Dortmund; verheiratet mit Emma geb. Mildenberg; Vater von Alice und Hedwig
Ehefrau Emma Levy geb. Mildenberg geb. 15.01.1863, Tochter Alice Levy geb. 02.12.1902, Tochter Hedwig Levy geb. 15.03.1893
Seine Frau Emma und die beiden Töchter Alice und Hedwig wurden deportiert und ermordet
Ernst Samson 1887 - 1918 und Abraham Blumenrath 1844 - 1897, Henriette Blumenrath 1839 - 1917
Ernst Samson 24.11.1887 - 22.10.1918
Abraham Blumenrath 18.05.1844 - 25.01.1897
Henriette Blumenrath geb. Hartig 22.08.1839 - 22.09.1917
Samson Ernst
24.11.1887 Essen (Ruhr)
22.10.1918 Ostfriedhof
Kaufmann, Inhaber der Firma Schuhhaus Samson, Westenhellweg 28, Dortmund; Wohnung Elisabethstraße 14, Dortmund; gefallen als Unteroffizier; Sohn des Kaufmanns Moses Samson und der Berta geb. Rosenberg; verheiratet mit Martha geb. Mendershausen
Blumenrath Abraham
18.05.1844 Hörde
25.01.1897 Dortmund
Sohn des Handelsmannes Heymann Blumenrath und der Elise geb. Levy; verheiratet mit Henriette geb. Hartig; Grabsteininshrift "unsere geliebten Eltern" zeigt mehrere Kinder auf; Bruder von Eduard Ehefrau Henriette Blumenrath geb. Hartig geb. 22.08.1839, Bruder Eduard Blumenrath geb. um 1845
Abraham Blumenrath war ein Kaufmann, der mehrfach neu anfangen musste, ohne dass wir heute noch erkennen können, warum er immer wieder scheiterte. Seine Ehefrau Henriette geb. Hartig war eine selbständige Gesinde-Vermieterin.
Grabstein Familie Rosenbaum
Johanna Rosenbaum 1846 - 1918
Wolf Rosenbaum 1842 - 1919
Moritz Jacobi 1875 - 1918
Rosenbaum Wolf
17.06.1842 Dortmund
29.03.1919 Dortmund
Metzger und Viehhändler, Prokurist der Firma J. Rosenbaum;
wohnte 1894 in der Marschallstraße 6, Dortmund:
1915 als Privatier in der Knappenberger Straße 42, Dortmund;
Sohn des Kaufmannes Levy Rosenbaum;
verheiratet mit Johanna geb. Cohen;
Vater von Leopold geb. 20.03.1882;
Grabsteininschrift "Unser lieber Vater" zeugt zumindest von einem weiteren Kind
Ehefrau Johanna Rosenbaum geb. Cohn geb. 15.06.1846,
Sohn Leopold Rosenbaum geb. 20.03.1882
Gemeinschaftsgrab mit Ehefrau Johanna und Sohn Leopold
Jacobi Moritz
03.04.1875
28.10.1918
Kaufmann, Inhaber der Firma Jacobi's Schuhhaus; Wohnung und Geschäft im Hause Kuckelke 35 /Ecke Schwanenwall, Dortmund; Sanitätsunteroffizier und Rechnungsführer in der Lazarett-Abteilung "Reinoldinum" des Königlichen Reservelazarett Dortmund;
Sohn des Moses Jacobi und der Amalie geb. Elsbach;
verheiratet mit Berta geb. Rosenberg;
Bruder von Arthur Vater Moses Jacobi geb. 13.08.1838,
Mutter Amalie Jacobi geb. Elsbach geb. 10.04.1848
Familie Hugo Grabe
Grabe Hugo
21.10.1881 Osnabrück
30.09.1917 Dortmund
Kaufmann; Mendestraße 18, Dortmund;
Sohn des Albert Grabe und der Bertha Pesschen geb. Goldschmidt;
verheiratet mit Margareta "Grete" geb. Cahn
Ehefrau Margareta Grabe geb. Cahn
Samuel 1851 - 1919 und Bertha Oppenheimer 1854 - 1922
Samuel Oppenheimer, Bertha Oppenheimer
Oppenheimer Samuel
16.08.1851 Külte (Ortsteil von Volkmarsen, Kreis Waldeck-Frankenberg)
14.06.1919 Dortmund Ostfriedhof
Kaufmann, Prokurist der Firma Oppenheimer & Co., Reinoldistraße 7, Dortmund; wohnte Klosterstraße 5, Dortmund;
verheiratet mit Bertha geb. Mendel; Grabsteininschrift "unser [herzensguter] Vater" zeugt von mehreren Kindern
Ehefrau Bertha Oppenheimer geb. Mendel geb. 28. März oder Mai 1854
Emma Luss geb. Meyer 1859 - 1920
Luss Emma geb. Meyer
02.05.1859 Bergkirchen (Kreis Minden)
11.01.1920 Dortmund Ostfriedhof
Kronprinzenstraße 46, Dortmund; Tochter des Pferdehändlers Joseph Meyer und der Rosalie geb. Felsenthal;
verheiratet mit dem Kaufmann Aron Luss;
Grabsteininschrift "Unserer lieben Mutter" zeugt von mehreren Kindern
Grabstelle wurde von Jacobi Luß erworben
Clara geb. Sostberg und Gustav Hammerschlag
Hammerschlag Gustav
14.07.1864
13.05.1927
Photographisches Atelier Hammerschlag, Westenhellweg 52; Wohnung Schwanenwall 29; Sohn des Aaron Hammerschlag und der Amalie geb. Kugelmann; in erster Ehe verheiratet mit Clara geb. Ostberg; in zweiter Ehe verheiratet mit Rosa geb. Ostberg;
Vater von Fritz und Ernst, beide aus erster Ehe
Ehefrau Clara Hammerschlag geb. Sostberg geb. 25.05.1866
Ein ziemlich mächtiges Grabmal ziert die letzte Ruhestätte von Gustav Hammerschlag und seiner ersten Ehefrau, Clara geb. Sostberg. Gustav Hammerschlag führte viele Jahre ein Fotografen-Atelier am Westenhellweg und hatte Filialen in anderen Städten. Fotos aus seinem Atelier finden sich sicherlich noch in vielen Dortmund Schubladen.
Isaac und Fritz Windmüller
Windmüller Isaac
06.02.1864 Beckum
14.05.1912
Sohn des Abraham Windmüller und der Pauline geb. Stern aus Herzebrock; verheiratet mit Hedwig geb. Victor aus Driburg, Vater von Siegfried Fritz geb. 1897, gefallen 10.8.1917,
Paul geb. 1898, gest. 1901,
Paula geb.1901 verh. mit Ernst Kahl aus Frankenthal,
Hedwig Windmüller heiratete erneut und wurde 1926 Witwe, sie emigrierte mit ihrer Tochter, deren Mann und Tochter in die USA, wo sie 1953 starb
Paula heiratete erneut und starb 1961 mit dem Namen Paula Löwenthal
Sohn Fritz Windmüller geb. 17.06.1897 - 1917
Isaak Windmüller trat vor dem Ende des 19. Jahrhunderts in die Kolonialwarenhandlung seines Schwagers Salomon Goldschmidt ein und übernahm sie später. Die Geschäfte gediehen wohl gut. Windmüller baute an der Rheinischen Straße neu und erwarb auch eine Gastwirtschaft in Barop. Der erfolgreiche Geschäftsmann starb jedoch bereits 1912. Auf seinem Grabstein angebracht ist auch eine Gedenkinschrift für seinen 1917 in Frankreich gefallenen einzigen Sohn Fritz.
Carl Baum und Willi Rosenbach
Baum Carl
16.10.1866 Dortmund-Mengede
13.02.1912
Sohn des Metzgers Jakob und der Kohanna geb. Stern;
verheiratet mit Amalie (Malchen) geb. Kahn;
Vater von: Bertha geb.1891, verh. mit Fritz Friedrich Rosenbach, Lina verh. mit Willi Rosenbach;
die gesamte Familie leitete das Geschäft Gebrüder Rosenbach in der Leopoldstraße 68/70, Dortmund; Amalie Baum, ihre Töchter und Fritz Rosenbach wurden deportiert und ermordet
Doppelgrab mit Schwager Fritz Rosenbach
Abraham Kahn
Kahn Abraham
23.01.1866
24.04.1919
Kaufmann, Inhaber eines Partiewaren Etagengeschäft, Johannesstraße 33;
Sohn des Alexander Kahn und der Berta geb. Zuckerberg; verheiratet mit Wilhelmine geb. Strauß;
Vater von Walter und Alfred Vater Alexander Kahn geb. 09.03.1819, Mutter Bertha Kahn geb. Zuckerberg geb. 21.10.1824
Grabstätte Schmittdiel
Helene Schmittdiel
1860 - 1930
Josef Schmittdiel
1844 - 1912
Ruhestätte Eheleute S. Dannenbaum
Dannenbaum Simon
17.08.1860
04.10.1910 Sohn von Levi Dannenbaum und Sara geb. Junerkmann;
verheiratet mit Johanna geb. Herzfeld
Ehefrau Johanna Dannenbaum geb. Herzfeld geb. 05.10.1857
Familiengrab.
Zusammengehörigkeit: Schwiegereltern Rela und Hermann Herzfeld, Töchter Johanna und Minna Pfeiffer
Als Schwiegersohn Simon Dannenbaum
In der ersten Hälfte seines Lebens wohnte und arbeitete Simon Dannenbaum in Lütgendortmund und verzog dann nach Dortmund, wo er die zweite Lebenshälfte verbrachte. Er hatte als Metzger die Tochter eines Metzgers geheiratet und nach dem Tod seines Schwiegervaters dessen Betrieb an der Münsterstraße übernommen und fortgeführt, bis er sich aus dem Berufsleben zurückzog. Das ziemlich mächtige Grabmal der Eheleute Dannenbaum auf dem Ostfriedhof zeugt wohl von einer guten finanziellen Situation.
▲
Mendelsohn Alex
1867 Mohrungen
27.03.1904 Dortmund
Kaufmann;
Sohn des Kaufmannes Abraham Mendelsohn und der Friederike geb. Buetow; verheiratet mit Margarethe geb. Cohn
Das Mendelsohn-Grab hat inzwischen sein Schmuckbild zurück erhalten: das von Benno Elkan geschaffene Relief. Es ist allerdings eine Kopie. Zum Schutz vor Diebstahl bleibt das Original unter Verschluss.
▲
Wolff Sara geb.Wolff
22.04.1853
14.02.1904
Tochter des Herz Wolff und der Sophia; verheiratet mit dem Kaufmann Max Wolff
▲
Salmang David
02.04.1827 Stolberg (bei Aachen)
19.12.1903 Dortmund
Metzger; Sohn des Aron Salmang und der Sophia; verheiratet mit Esther geb. Roer; Grabsteininschrift "unser lieber Vater" zeugt von mehreren Kindern
▲
Baum Jettchen geb. Strauss
12.03.1863 Seppenrade
(Kreis Lüdinghausen)
08.12.1910
Tochter des Phlilipp Strauss und derJeanette geb. Sterin;
verheiratet mit Isaac, geb. 11.11.1852;
Grabsteininschrift "Unsern Eltern" zeigt mehrere Kinder auf
Ehemann Isaac Baum
geb. 11.11.1852
▲
Baum Jettchen geb. Strauss
12.03.1863 Seppenrade
(Kreis Lüdinghausen)
08.12.1910
Tochter des Phlilipp Strauss und derJeanette geb. Sterin;
verheiratet mit Isaac, geb. 11.11.1852;
Grabsteininschrift "Unsern Eltern" zeigt mehrere Kinder auf
Ehemann Isaac Baum
geb. 11.11.1852
▲
Dannenbaum Simon
17.08.1860
04.10.1910
Sohn von Levi Dannenbaum und Sara geb. Junerkmann;
verheiratet mit Johanna geb. Herzfeld
Ehefrau Johanna Dannenbaum geb. Herzfeld geb. 05.10.1857
Familiengrab.
Zusammengehörigkeit: Schwiegereltern Rela und Hermann Herzfeld, Töchter Johanna und Minna Pfeiffer
Als Schwiegersohn Simon Dannenbaum
.
▲
Sieger Moses
13.04.1831 Brackel
01.10.1910
Kaufmann und Sattler; Sohn des Metzgers Piktor Sieger und der Bertha geb. Nordheim; heiratete am 08.10.1868 die Fanny geb. Weinberg; Vater von Julius geb. 1869, Amalie geb. 1870, gest. 1870, Johanna geb. 1873, Hulda geb. 1873 und Ida geb. 1874 Ehefrau Fanny Sieger geb. Weinberg geb. 22.09.1836, Tochter Ida Sieger geb. 25.07.1874
Doppelgrab der Eheleute Sieger
▲
Frankenstein Nathan
25.02.1821 Hemeringen
04.04.1897
Sohn des Kaufmannes Lucas Frankenstein und der Henriette geb. Lilienfeld; verheiratet mit Rosa geb. Bruch; Vater von Salomon Sali geb. 20.06.1850, Alwine geb. 24.07.1852, Emilie geb. 22.09.1856 und Ottilie geb. 28.10.1860 Ehefrau Rosa Frankenstein geb. Baruch geb. 27.08.1824, Tochter Alwine Frankenstein geb. 24.07.1852
Kaufmann Ludwig Lilienthal wurde ebenfalls hier bestattet.
Moses Sieger
Sieger Moses
13.04.1831 Brackel
01.10.1910
Kaufmann und Sattler; Sohn des Metzgers Piktor Sieger und der Bertha geb. Nordheim; heiratete am 08.10.1868 die Fanny geb. Weinberg; Vater von Julius geb. 1869, Amalie geb. 1870, gest. 1870, Johanna geb. 1873, Hulda geb. 1873 und Ida geb. 1874 Ehefrau Fanny Sieger geb. Weinberg geb. 22.09.1836, Tochter Ida Sieger geb. 25.07.1874
Doppelgrab der Eheleute Sieger
Nathan Frankenstein 1821 - 1897
Frankenstein Nathan
25.02.1821 Hemeringen
04.04.1897 Dortmund
Sohn des Kaufmannes Lucas Frankenstein und der Henriette geb. Lilienfeld; verheiratet mit Rosa geb. Bruch; Vater von Salomon Sali geb. 20.06.1850, Alwine geb. 24.07.1852, Emilie geb. 22.09.1856 und Ottilie geb. 28.10.1860 Ehefrau Rosa Frankenstein geb. Baruch geb. 27.08.1824, Tochter Alwine Frankenstein geb. 24.07.1852
Kaufmann Ludwig Lilienthal wurde ebenfalls hier bestattet.
Frankenstein war in der Stadt so bekannt, dass er im Rückblick des "General-Anzeiger für Dortmund und die Provinz Westfalen" auf die Entwicklung Dortmunds im 19. Jahrhundert namentlich als Fabrikant genannt wurde! Er stellte in seiner Fabrik Nähmaschinen her und bot auch Nähmaschinen anderer Hersteller zum Verkauf an.
Familie Carl Kemper
Kemper Karl
19.04.1854 Neuenkirchen (Kreis Wiedenbrück)
11.05.1925 Dortmund
Kaufmann; Südwall 37, Dortmund; verheiratet in erster Ehe mit Fanny geb. Eppinghausen,
verheiratet in zweiter Ehe mit Sofia geb. Zilverberg
Doppelgrab mit Fanny Kemper,
Tochter des Kaufmannes Abraham Eppinghausen und der Esther geb. Strauss; Schwester von Gottschalk Eppinghausen
Johanna geb. Peuckmann 1857 - 1931 und Giesbert Umbach 1854 - 1915
Clara geb. Kohn und Philipp Friede
Philipp Friede 1848 - 1922
Clara Friede geb. Kohn 1863 - 1923
Friede Clara Kohn
20.12.1863 Hüls
05.12.1923 Dortmund
Ehefrau des Kaufmannes Philipp Friede
Ehemann Philipp Friede geb. 10.07.1848
Friede Philipp
10.07.1848 Oestrich (Kreis Iserlohn)
05.07.1922 Dortmund
Kaufmann, Inhaber des "Bettenhaus Ph. Friede", größtes Spezialgeschäft für Betten, Weißlackmöbel, Bettwäsche, Dekorationen, Ostenhellweg 41, Dortmund;
Sohn des Moses Joseph Friede und der Bela geb. Blumenthal
Hermann und Helene Auerbach
Herm. Auerbach
1868 - 1925
Helene Auerbach geb. Sternau
1870 - 1934
Auerbach Hermann
05.02.1868
18.06.1925
Kaufmann, Teilhaber der Firma Hermann Auerbach, Agenturgeschäft und Großhandlung in Kolonialwaren, Mühlenfabrikaten, Fettwaren, Landesprodukten, Zucker und Südfrüchten, Kaiserstraße 80, Dortmund; Mitglied der Repräsentanten-Versammlung; Sohn des Kaufmanns Salomon Auerbach und Emma geb. Wolff; verheiratet mit Helene geb. Sternau; mehrere Kinder
Vater Salomon Auerbach geb. 27.04.1832, Mutter Emma Auerbach geb. Wolff geb. 24.08.1837,
Ehefrau Helene Auerbach geb. Sternau geb. 03.02.1870
Das Grabmal der Eheleute Hermann Auerbach und Helene geb. Sternau auf dem Ostfriedhof befand sich bis Anfang 2022 in einem perfekten Zustand. Selbst die Inschrift aus aufgesetzten Metallbuchstaben war noch vollständig vorhanden. Ein starker Sturm im Februar 2022 entwurzelte den hinter dem Grabmal stehenden Baum, dabei wurde das Fundament des Auerbach-Grabmals gehoben, der darauf stehende Grabstein stürzte um und zerbrach in mehrere Teile.
Sally Schild und Bertha Schild geb. Bacharach
Sally Schild
xxxx - 1934
Bertha Schild geb. Bacharach
xxxx - 1901
Ein mächtiger Block, der mehr einem Altar als einem Tisch ähnelt, mit erhaben ausgearbeiteter Schrift und einem aufgeschlagenen Buch auf der Oberseite, ist das Grabmal für den Kaufmann Sally Schild und seine Ehefrau Bertha geb. Bacharach auf dem Ostfriedhof. Sally Schild setzte sich in einem außerordentlichen Maße für seine Gemeinde ein, denn mehr als 40 Jahre gehörte er der Repräsentanten-Versammlung der Synagogen-Gemeinde Dortmund an. Deshalb wurde er auch zum Ehrenmitglied der Gemeinde ernannt.
Gottlieb August Melcher 1844 - 1906 und Helene Melcher
Künstler Benno Elkan schuf für den Bergwerksdirektor Gottlieb August Melcher und seine Frau Helene eine monumentale Grabstätte, die heute nicht mehr vollständig ist.
- Jahr: 1908
- Beschriftung: Inschrift:
- oben: „G. A. MELCHER“; „GEB./ 5. MAI/ 1844“; „GEST./ 28. NOV./ 1906“
- li.: „GOTTLIEB AUG. MELCHER/ 5.MAI 1844/ 28.NOV. 1906“
re: „HELENE MELCHER/ unleserlich LIEBER/NOV. 1865/JUN. 1915“; - Sign. u. dat.: „BENNO ELKAN 1903“ unten linke Mitte
- Technik/Material: Relief: römischer Travertin; Grabstein: Muschelkalk
- Höhe: Relief: 0,84 m; Grabstein: ca. 1,11 - 2,71 m
- Breite: Relief: 1,05 m; Grabstein: 1,83 – 4,54 m
- Kunstwerknr.: 44143-014
Die Grabstätte besteht aus einer schlichten Architektur. Der mittlere Teil baut sich über einem hohen Sockel auf. In den unteren Steinblock ist ein Relief aus römischem Travertin eingelassen, der obere enthält eine große ellipsenförmige Nische. Eine auskragende Platte schließt die Stele nach oben hin ab. Beidseitig wird der Mittelteil von halbhohen Steinplatten flankiert. Hier sind die Namen und Lebensdaten der Verstorbenen eingraviert. Das Grabmal präsentiert sich heute unvollständig. In der Nische stand einst eine Bronzebüste Melchers. Sie zeigte ihn in fortgeschrittenem Alter mit langem Bart. Melchers Antlitz ist auch auf dem Relief „Abschied“ wiederzuerkennen. Es zeigt ihn als Wanderer, der - plötzlich abberufen – das Leben verlässt. Die Venus symbolisiert die Liebe, der Jüngling mit Hammer sein Lebenswerk.