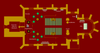St. Pauli-Kirche
St. Pauli ist eine gotische Hallenkirche. Die dreijochige Hallenkirche mit dem mächtigen Turm auf quadratischem Grundriss prägt das Stadtbild im südwestlichen Teil der Stadt. Sie gehört zur evangelischen St.-Petri-Pauli-Gemeinde, die mit etwa 8100 Gemeindemitgliedern die größte evangelische Kirchengemeinde in Soest ist und zum Kirchenkreis Soest-Arnsberg der Evangelischen Kirche von Westfalen gehört.
Erzbischof Philipp von Heinsberg beschloss gegen Ende des zwölften Jahrhunderts, die Stadt Soest auszubauen. Das Stadtgebiet wurde in vier Sektoren, sogenannte Hofen, geteilt. Jede Hofe sollte eine Kirche bekommen; St. Pauli wurde die Kirche der südlichen Hofe. Bis dahin war St. Petri, auch „Alde Kerke“ genannt, die einzige Stadtkirche gewesen. Eine St.-Pauli-Kirche wurde 1229 erstmals urkundlich in Soest erwähnt. Dabei handelte es sich vermutlich noch um eine romanische Vorgängerkirche. Um 1350 begann der Umbau zur jetzigen gotischen Kirche, der nach dem Ergebnis dendrochronologischer Untersuchungen im Dachstuhl bis 1405/06 dauerte. Das zweifach aufgeständerte Kehlbalkendach der Kirche zählt heute neben dem der Wiesenkirche zu den weitgehend erhaltenen gotischen Kirchendächern der Stadt Soest und ist von überregionaler Bedeutung. Die ältesten Teile der Kirche sind das Langhaus und der Turm; der Chor wurde etwa 100 Jahre später als letzter Teil angefügt.
Eine große Rolle in der Soester Stadtgeschichte spielte St. Pauli während der Reformationszeit. Eine erste reformatorische Predigt hielt 1530 der humanistisch gebildete Vizekurat Johann Kelberg, der zuvor Pater im Soester Dominikanerkloster gewesen war. Er stellte sich offen auf die Seite der Reformation und wurde der erste lutherische Pfarrer in Soest. Während des katholischen Interims bestellte der katholische Pfarrer den Kaplan Hartlieb Sennekamp. Dieser predigte schon nach kurzer Zeit unkatholisch und sollte aus dem Amt entfernt werden. Der Rat der Stadt bestärkte den Kaplan; jedoch musste Sennekamp entlassen werden, da der Kaiser intervenierte. Trotzdem kehrten die Bürger nach und nach zum evangelischen Glauben zurück. Nach dem katholischen Interim wurde St. Pauli 1552 als erste Kirche wieder evangelisch. Walther von Stollwyck bekam die Erlaubnis, dort das Abendmahl „in beiderlei Gestalt“ zu feiern.
Im Zweiten Weltkrieg blieb die Kirche von Zerstörungen weitgehend verschont; bis 1950 wurde sie renoviert. Von 1948 bis 1960 war sie gemeinsame Gottesdienststätte für die St.-Pauli- und die St.-Thomä-Gemeinde. Da die St.-Pauli-Gemeinde in den 1960er Jahren kleiner wurde, vereinigte sie sich 1972 mit der St.-Petri-Gemeinde zur „St.-Petri-Pauli-Gemeinde“. Die Kirche wurde kurz darauf wegen Baufälligkeit geschlossen. Von 1980 bis 1995 wurde sie umfassend restauriert und anschließend wiedereröffnet. Die Kirche wird für Gottesdienste, Amtshandlungen und Konzerte genutzt.
"Christus hat dem Tode die Macht genommen" –
Geschichte einer Skulptur
Wer die Turmhalle der St. Paulikirche betreten hat, wird sie schon bemerkt haben: eine Bronzeskulptur mit Kreuz und Schlange, darunter in Großbuchstaben das Bibelwort "Christus hat dem Tode die Macht genommen" (2. Timotheus 1,10), durch Abstandsbolzen schwebend an der Nordwand der Turmhalle angebracht.
Die Skulptur wurde der Kirchengemeinde von der Familie des langjährigen Pauli-Pfarrers Wilhelm Thurmann als Schenkung angeboten. Weil auch die Kirchengemeinde der Auffassung war, dass diese Skulptur mit ihrer österlichen Botschaft sehr gut zur Paulikirche und insbesondere zum Kolumbarium passt, wurde sie - nach sorgfältiger Auswahl des Standortes, gründlicher Aufarbeitung durch die Kunsthandwerker Christof und Michael Winkelmann aus Günne und Genehmigung durch das Denkmalamt - an ihrem jetzigen Ort angebracht.
Die Skulptur entstand 1976 als Gemeinschaftsarbeit von Beate Pfannschmidt, Gisela Korpiun und Marie-Luise Thurmann-Phillips, der Witwe von Pastor Wilhelm Thurmann (bis 1966 Pfarrer der Ev.-luth. St. Pauli-Kirchengemeinde Soest). Der Anlass dieser Arbeit war ein sehr trauriger: die Tochter von Marie Luise und Wilhelm Thurmann war als Studentin in jungen Jahren tödlich verunglückt. Die Skulptur stand lange als Hoffnungszeichen auf der Familiengrabstelle Thurmann auf dem Hauptfriedhof in Lippstadt, wo in den 70er Jahren erst die Tochter und später auch der Vater beigesetzt wurden. Als Marie-Luise Thurmann schließlich mit 96 Jahren in 2017 verstarb, wurde sie auf ihren Wunsch im Kolumbarium St. Paulikirche beigesetzt. Dort, wo sie selber jahrzehntelang Gottesdienste mit der Gemeinde gefeiert hat. Und wo die von ihr geschaffene Skulptur als Zeichen ihrer christlichen Zuversicht Besucher der Paulikirche an den Grund unserer christlichen Hoffnung erinnert: "Christus hat dem Tode die Macht genommen".
Altar
Das Buntglasfenster des südlichen Vorchores stammt aus der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Dargestellt sind verschiedene Heilige. Das Fenster überstand den Zweiten Weltkrieg, da es ausgelagert wurde. Wohl im 20. Jahrhundert wurden mehrere Fenster des Chores zum heutigen Fenster zusammengesetzt. Dabei wurden einige Heiligenfiguren falsch zusammengefügt. Möglicherweise entstammten die Glasmaler der gleichen Malschule wie jene des Westfensters des Altenberger Domes.
Die Dächer des Langhauses und des Turmes waren seit längerer Zeit sanierungsbedürftig. Da 2004 Schieferplatten vom Turm herabfielen, musste eine Notsicherung mit einem Netz vorgenommen werden. In den Jahren 2017 und 2018 wurde das Dachwerk beider Dächer schließlich statisch ertüchtigt und instand gesetzt. Zudem wurden das Langhaus mit Naturschiefer in altdeutscher Deckung und der Turmhelm vollständig in Blei neu eingedeckt und somit der ursprüngliche Bauzustand wiederhergestellt.
Die Orgel der Paulikirche
Die Walcker-Orgel in der St. Paulikirche
Im Jahre 1893 beschloss das Pauli Presbyterium unter dem Vorsitz von Pfarrer Friedrich Kögel, die wohl nicht mehr ganz zeitgemäße, mechanische Varenholt-Schneider-Orgel von 1675 aufzugeben und durch ein neues, dem Zeitgeschmack entsprechendes Instrument zu ersetzen. Unter den Bewerbungen der Orgelbauer befand sich auch ein Angebot der damals schon weltbekannten Firma Eberhard Friedrich Walcker in Ludwigsburg/ Württemberg. Nach gründlicher Prüfung der Angebote anderer Bewerber bekam schließlich Walcker den Auftrag. Die „Königlich württembergische Hof orgelbau-Anstalt E.F.Walcker und Cie.“ entwarf ein Instrument mit 28 Registern, verteilt auf Hauptwerk, Schwellwerk und Pedal, Traktur pneumatisch mit Kegelladen (Pneumatik = die Tonventile für die Pfeifen werden durch kleine belederte Bälgchen, später dann durch dünne Leder-Membranen, betätigt). Das schöne alte Barock-Gehäuse von 1675 blieb erhalten. erfuhr eine regelmäßige Pflege und überstand sogar nahezu unversehrt beide Weltkriege (Die Orgel wurde nie ausgebaut!). Im Februar 1950 reinigte und reparierte die bekannte westfälische Orgelbau-Firma Anton Feith aus Paderborn die Orgel. Eine grundlegende Restaurierung des Instruments wurde in den Jahren 1992-1994 von Orgelbau Hermann Eule aus Bautzen/ Sachsen durchgeführt, recht zeitig zum 100. Jubiläum 1995. Dank intensiver Wartung und Pflege durch die Firma Eule und den Küster der Paulikirche hat die Walcker-Orgel schließlich auch ihr 125-jähriges Jubiläum erreicht. Mögen sich noch viele Generationen an diesem Juwel der Spätromantik erfreuen! Die Orgel wurde im April 1895 fertig gestellt und per Eisenbahn von Ludwigsburg nach Soest transportiert. Am 1. Mai wurde vertragsgemäß mit dem Aufbau der Orgel in der Paulikirche begonnen.
Die Firma Walcker baute nach dem Orgel-Neubau für die Paulikirche 1895 noch zwei weitere Instrumente in der Nähe von Soest: Weslarn 1898 und Lohne 1906. Diese beiden Orgeln sind auch erhalten.
Frauen- und Herrenpriechen
Die Priechen* (Holzemporen für die Adeligen und Patrizier) aus dem 16. Jh. im Westteil neben der Orgel.
Adelssitze in der Paulikirche - die Priechen wurden restauriert
Priechen? – manche fragen, was das denn ist. Das Online-Lexikon Wikipedia klärt auf: "Mit dem Ausdruck Prieche wird in Norddeutschland der vom allgemeinen Kirchengestühl abgesonderte Sitzplatz der höheren Stände einer Kirchengemeinde bezeichnet." Also eine Empore für die Adeligen, die privilegiert saßen, aber auch für die Erhaltung und die Kosten der Prieche zuständig waren.
In der Paulikirche befinden sich zwei Priechen an der Westwand im hinteren Teil der Paulikirche: die auffälligere Prieche an der Nordseite ist reich verziert und der obere Teil ist mit einem Holzgitter mit Schiebefenstern versehen. Man hat vermutet, dass es sich um eine "Frauenprieche" handelt, in der die adeligen Damen vor Blicken geschützt waren. In späteren Zeiten haben aber definitiv auch Herren dort gesessen, denn ein Theodor und ein Johann haben ihre Namen ins Holz eingraviert. Nach Hubertus Schwartz gehörte diese Prieche zum "ehem. v. Schmitzschen Hause Paulistraße 12".
Die Prieche an der Südseite ist dagegen nach oben offen und unvergittert. Gemeinhin gilt sie als "Herrenprieche". Datiert werden die Priechen auf das Jahr 1600 - 1620.
Gedenk-Pieta
Das oft übersehene Kunstwerk, mit dem in der Pauli-Kirche an die 36 im 1. Weltkrieg gefallenen Gemeindemitglieder erinnert wird. Das Kunstwerk aus Holz befindet sich weit hinten an der Nordwand der Kirche. Es wurde passgenau in eine uralte Nische gestellt. Sie muss lange als sogenannte „Heilig-Grab-Nische“ fungiert haben: Karfreitag/-Samstag legte man als Vergegenwärtigung eine Figur des toten Jesus hinein.
Im Herbst 1923 wurde das besondere Erinnerungs-Kunstwerk hier aufgestellt. Walter von Ruckteschell hat es geschaffen. In den hohen Sockel sind die Namen der Kriegstoten geritzt. Und auf dem Sockel eine sogenannte Pietà: Mutter Maria hat ihren toten Sohn auf ihrem Schoß. So hat sie ihn als kleines Kind schon gehalten. Und nun… Ein Arm von Jesus ist leblos zu Boden gefallen, sein Kopf ist nach hinten gesackt. Eine Hand von Maria schmiegt sich - zart und fest zugleich - an ein Knie ihres Sohnes. Und ihr Blick geht trauernd in die Weite. Es ist ein Kunstwerk, für das sich auch der große Ernst Barlach nicht schämen müsste. Es ist gut, dass über den Namen im Sockel keine Überschrift prangt, in der (wie sonst oft bei entsprechenden Denkmälern) vom Heldentod fürs Vaterland die Rede ist.
Tabernakel
Gotischer Tabernakel (Sakramentshäuschen) im Chorraum.
Die Namensgeber der Kirche: Paulus und Petrus.
Eine von zwei gotische Holztruhen in Sekundärverwendung als Opferstöcke.
Kanzel
Die Renaissancekanzel aus der Zeit um 1580. An der Unterkante der Kanzel die freigelegten Originalfarben.
Wandmalereien
Die freigelegten gotischen Wandmalereien werden ebenfalls der Schule des Conrad von Soest zugeordnet.
Epitaph zur Erinnerung an Thomas Schwartz
Wie überall in Deutschland so erregten auch in Soest die Missstände in den Klöstern, der weltliche Lebenswandel des Klerus und ihre besondere soziale Stellung Neid und Missfallen in der Bevölkerung. 1531 kam es zum Thesenanschlag in Soest und unter dem Druck einer großen Bevölkerungsmehrheit musste der Rat der Einführung der Reformation zustimmen. Sämtliche Kirchen - bis auf St Patrokli und die Klöster - wurden der neuen Lehre geöffnet und eine evangelische Kirchenordnung aufgestellt. Nach einer zwischenzeitlichen Rückkehr zu den alten Glaubensverhältnissen festigte sich nach 1555 der protestantische Glauben nun unter der Führung des Rates, der die kirchlichen Hoheitsrechte ausübte. Es bildet sich eine eigenständige Soester evangelisch-lutherische Kirche, die in dieser Form bis 1817 bestand. Die überwiegende Mehrheit der Soester Bevölkerung hatte sich zum lutherischen Glauben bekannt, daneben gab es aber noch eine katholische Minderheit, vor allem unter den patrizischen Geschlechtern. Im 17. Jahrhundert entstand auch eine reformierte Gemeinde. Das Epitaph von 1580 trägt eine Inschrift, die die Verdienste und den Lebenslauf des Verstorbenen würdigt. Darunter befindet sich das Tafelbild, das eines der Hauptthemen der evangelischen Lehre, die Verkündung des Wortes Gottes, thematisiert, In einem perspektivisch nicht ganz richtig dargestellten Kirchenraum predigt der Pfarrer Schwartz auf der Kanzel vor seiner Gemeinde. Der Innenraum weist einige Elemente der Renaissance-Architektur auf. In der Mitte steht das Kruzifix. Die Männer und Frauen sitzen getrennt und sind der Mode der Zeit entsprechend gekleidet.
Textinhalt: Übersetzung Boris Krüger
Epitaph zur Erinnerung an den ehrwürdigen Mann Gottes Thomas Schwartz, den unermüdlichen Pastor dieser Kirche, der am Tage vor den lden des August (12. August) im Jahre des Herrn 1580 fromm in Christus gestorben ist.
Sieh, das ist des Herrn Thomas Schwartz sehr trauriges Grab, sanft ruhen in diesem Boden die Gebeine nach ihrer Bestattung, der Geist ist, begleitet von den himmlischen Heiligen, zu den luftigen Gefilden zurückgekehrt und erfreut sich der Güter. Aber wie er von nicht unbekannten Vorfahren abstammte, so kam auch er selbst ihnen durchaus an Tugend gleich. Denn sein Vater, der denselben Namen trug wie der Sohn, war Bürger dieser Stadt und Angehöriger des Rates. Unter den ehrbaren Frauen war die Mutter mit Namen Walburgis ein leuchtendes Beispiel für eine liebliche Gattin. So ertrug er auch in kraftlosem Geiste, was zu ertragen war. Wie der Vater charakterfest und im Herzen klug war, so wie die Mutter von Jugend auf einen unverdorbenen Charakter besaß, so bewahrte sie auch keusch den Bund der Ehe. Die richtigen Lehrsätze billigte der Vater mit reinem Herzen, die falschen Lehrsätze verwarf dagegen der Vater. Die wahren Lehrsätze bekannte frommen Herzens die Mutter, sie verwarf dagegen die nichtigen Hirngespinste des Papstes. Denn wie der Vater pflegt der Sohn zu sein. Dieser erlernte hier in Soest mit großer Anstrengung die Kunst eines Pastors (vermutlich Rhetorik) und die übrigen Künste (Grammatik, Dialektik, Geometrie, Musik, Astronomie), soweit es die damaligen Zeiten zuließen. Der Sohn folgt diesen Eltern verdienstvoll mit Tugend.
Eine reichhaltigere Geistesbildung suchte er mit Hilfe der Künste (s.o.), während er darauf in der Fremde gelehrte Männer aufsuchte. So trug er Sorge, dadurch dass er häufig Braunschweig, das glänzende Haus deines Lyzeums besuchte, vieles zu lernen. So bereiste er das Meer, das die baltischen Schiffe durchfahren. Sobald man ihn die klaren Einsichten der sehr gelehrten Schule gelehrt hatte, nahm jener sich der heiligen Themen (Theologie) mit höchster Liebe an und las er mit Emsigkeit die heiligen Bücher. So begann er, als er auf diese Weise hinreichend unterwiesen worden war und es den Gelehrten gefiel, dein Wort, Christus, zu lehren. Doch von drei gelehrten Doktoren wurde er zuvor geprüft, die zu gewichtigen Zeugen seiner Gelehrsamkeit und seines Glaubens wurden. Mit wie großer Sorgfalt er immer diese Aufgabe versah und mit wie großem Eifer, vermag niemand zu sagen. O, wie oft hat er die rasende Menge mit seiner Stimme gebändigt! O, wie oft hat er die reißenden Wölfe mit seinem Munde vertrieben! Weil er mit starkem Herzen die vernünftige Lehre bekannte, war er allen Häretikern ein erbitterter Feind. Dass er ein in vielem ausgezeichneter und gläubiger Pastor war, dafür war die teure Vaterstadt ein hinreichend zuverlässiger Zeuge. Er starb in seinem 53. Lebensjahr. Johannes Kirchmann hat dieses geschaffen.
Epitaph des Lubertus Florinus
Zur Erinnerung an den ehrwürdigen, weisen, äußerst bedeutenden und gebildeten Mann, Herrn Lehrer Lubertus Florinus. Einst Rektor der bekanntesten Schulen Westfalens, nämlich in Wesel, Soest, Lemgo und außerdem in Antwerpen, ein Lehrer, der sich sowohl im öffentlichen Leben besonders um die Studien von theologischen Schriftwerken als auch im privaten Leben um sich und viele andere verdient gemacht hat, hat Johannes Olearius aus Wesel; Doktor der heiligsten Theologie, dieses Denkmal und Mahnmal zur Trauer aufgestellt.
Hier bedeckt die Erde den Leib des Florinus. Seufzt nun Klagelieder, ihr jungen Musendiener. Eine nützlich allumfassende Tüchtigkeit zum Leben verkündete er Kindern/Jungen. Am meisten mehrte er den Christus liebenden Schulen den Ruhm. Lemgo war seine Vaterstadt, das heilige Wittenberg traf ihn als bewundernswerten/gottbegeisterten Hörer der Lehre Luthers. Dann unterrichtete er Friesen und die Kinder seiner Heimatstadt und die Jugend der Stadt Soest. Danach zierte er durch seine Wissenschaft das Lyzeum von Wesel. Viele Jahre mühte er sich ab, viel Gutes vollbrachte er, des halb soll mir Florinus unter den ersten sterblichen Museen genannt werden und als letzter - und nicht als mittelmäßiger. Unter diesem Stein liegen die sterblichen Überreste des gelehrten Greises Lubertus Florinus. Weinet und trauert ihr berühmten Schulen. Lemgo hat diesen Mann geboren, Wittenberg hat ihn mit Luther als Lehrer erzogen und er selbst unterrichtete bald die Heimat und die Friesen. Dann hatte ihn die Soester Schule, dann hatte diesen die Weseler Schule als getreuen Vorsteher über mehrere Jahre inne. Nach diesen verehrten mehrere belgische Städte, darunter auch Antwerpen, die von vielen gelehrten Männern bewohnt waren, diesen Mann.
Sie verehrten diesen Mann, unter dessen Anleitung die vortreffliche Jugend an Charaktereigenschaften und Frömmigkeit vermehrt werden sollte. Als er emeritiert und 70 Jahre alt war, gab er sich dir, Christus, mit seinem letzten Gebet hin. Das Westfälische Erdreich beherbergt den Körper, der gute Ruf fliegt ewig über die Erde, der Geist des Verdienten ist bei den Sternen. Die Grazien und die Musen befahlen, dass dieses Epitaph dem Lehrer gegeben wird, die anmutige Camoena gab den Schülern dieses Epitaph- zur Erinnerung an die alte Zeit. Bleibt noch, dass du frommer Leser erkennst: Hier wird kein Ruhm erworben. Es drängt sich jedoch gerechte Liebe auf.
Er ist friedlich im Glauben an Christus am 21. Oktober des Jahres 1589 entschlafen.
Taufstein
Grabplatten im Vorraum
Grabplatten im Chorraum
Chronik der Pfarrer an St. Pauli
bis 1536 | Antonius Schürmann | ||
1531 - 1548 | Johannes Kelberg (Vicecurat, führt die Reformation ein) | ||
1548 - 1549 | Johannes Reichfeld | ||
1549 - 1550 | Hartlieb Sennekamp | ||
1550 - 1551 | Hermann Schilder | ||
1551 - 1552 | Heinrich Höcker | ||
1552 - 1553 | Walter von Stolwyck | ||
1553 - 1554 | Erasmus Wegenhorst | ||
1554 - 1555 | Matthias Chesselius Bracht | ||
1555 - 1580 | Thomas Schwartz s.o. | ||
1575 - 1581 | Johannes Borgers oder Borris | ||
1581 - 1610 | Johannes Berotte | ||
1610 - 1635 | Bertram Matthias Harhoff | ||
1635 - 1657 | Mag. Johannes Gerling | ||
1657 - 1678 | Mag. Georg Westorp | ||
1678 - 1711 | Mag. Johann Heinrich Sybel | ||
1712 - 1723 | Gerhard Goswin Andreae | ||
1723 - 1733 | Mag. Johann Christoph Sybel | ||
1733 - 1757 | Johann Arnold Mönnich | ||
1757 - 1807 | Johann Friedrich Dohm s.o. | ||
1807 - 1839 | Friedrich Dreckmann | ||
1839 - 1841 | Friedrich Rumpäus | ||
1842 - 1845 | Karl Ludwig Josephson | ||
1845 - 1850 | Julius Schimpff | ||
1850 - 1874 | Gustav Leopold von der Crone | ||
1875 - 1911 | Friedrich Kögel | ||
1912 - 1915 | Emil Steinigeweg | ||
1915 - 1937 | Lic. Johannes Meßner | ||
1937 - 1966 | Wilhelm Thurmann | ||
Nach dem Zusammenschluss von Pauli- und Petrigemeinde 1972 wurde der Paulibezirk Teil des Südbezirks der Petri-Pauli-Kirchengemeinde. Für ihn waren formal die Inhaber der 2. Pfarrstelle der Gemeinde zuständig. Wegen seiner Eigenständigkeit wurde die seelsorgerliche Betreuung aber häufig Pfarrern im Entsendungsdienst übertragen - oder aber Sup. Althoff, der neben seiner kreiskirchlichen Tätigkeit einen Seelsorgebezirk betreuen wollte.
1972 - 1984 | Albrecht Winter |
1984 - 1993 | Sup. Bertold Althoff |
1993 - 1995 | Pfr.i.E. Matthias Mengel |
1996 - 2001 | Pfrn i.E. Antje Grüter |
2003 - 2006 | Pfr.i.E. Karsten Dittmann |
2006 wurde die Entsendungsdienststelle gestrichen und die Bezirke der Gemeinde neu aufgeteilt. Seitdem gehört der Paulibezirk zum Pfarrbezirk 1 der Gemeinde. 2009 wurde in die Kirche ein Kolumbarium eingebaut und sie damit einer neuen Nutzung zugeführt. Seitdem betreut Pfr.Dr.Welck Kolumbarium und Kirche, Pfr. Röger den Pauli-Seelsorgebezirk.
seit 2006 | Bernd-Heiner Röger |
seit 2009 | Dr. Christian Welck |